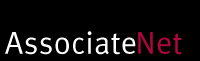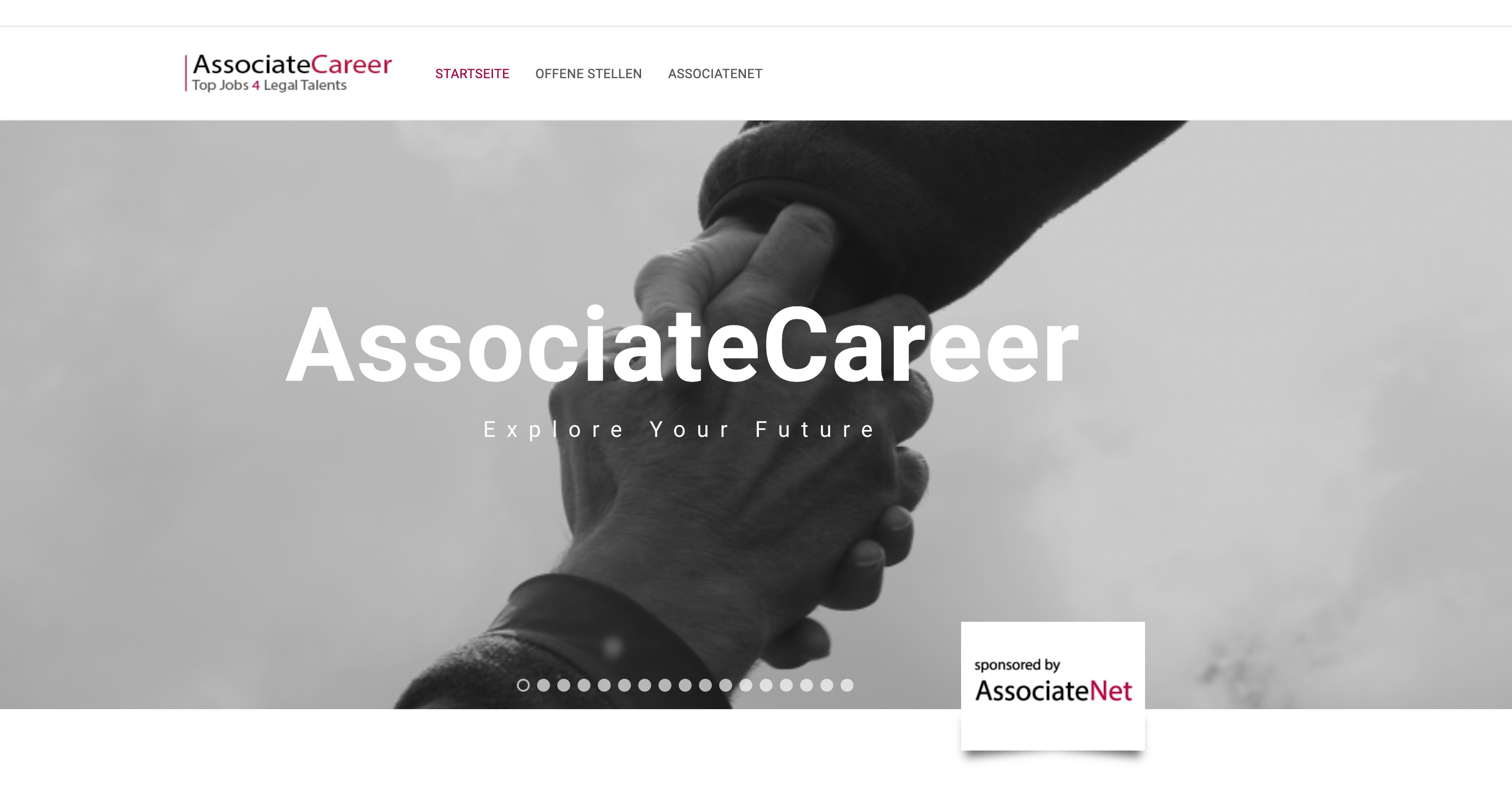Auch ein Landwirt darf nicht bauen, was er will – Klarstellungen zur besonderen Schonung des Außenbereiches
 VGH München, Urteil vom 08.04.2014, Az: 2 B 12.2602, veröff. unter www.landesanwaltschaft.bayern.de
VGH München, Urteil vom 08.04.2014, Az: 2 B 12.2602, veröff. unter www.landesanwaltschaft.bayern.de
Sachverhalt: A ist Landwirt in der kreisangehörigen Gemeinde G, Landkreis L. Er zeigt am 4. April 2014 den Baubeginn an für eine landwirtschaftliche Gerätehalle mit Saatgut- und Erntespeicher und einer Grundfläche von 100m². Eigentümer des Baugrundstücks im Außenbereich ist B, der auch Eigentümer der Halle werden soll und die Halle auch finanziert, aber keine Landwirtschaft betreibt. A ist der Ansicht, dass die Halle landwirtschaftlichen Zwecken dient und von daher genehmigungsfrei errichtet werden könne. Nach Errichtung werde er die Halle von B pachten, ein entsprechender Vertrag wird vorgelegt. Der Pachtzins soll 300 Euro jährlich betragen, üblich wären etwa 4.000 Euro jährlich.
Das Landratsamt L stellt sich auf den Standpunkt, dass das Vorhaben keinen landwirtschaftlichen Zwecken dient, da B keine Privilegierung habe. Außerdem sei festgestellt worden, dass es auf der Hofstelle des A mehrere leerstehende Scheunen gibt, die sich als Lager eignen würden. Das Vorhaben bedürfe daher einer Baugenehmigung, die aber nicht erteilt werden könne, da das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspreche.
A erhebt Klage mit dem Antrag festzustellen, dass für die Errichtung des Saatgut- und Erntespeichers keine Genehmigung erforderlich sei, hilfsweise den Freistaat Bayern zur Erteilung der Genehmigung zu verpflichten. Er macht geltend, es sei seine betriebliche Entscheidung, wo die Halle gebaut werden soll. Es spiele auch keine Rolle, wer Eigentümer des Baugrundstücks sei, entscheidend ist, dass das Gebäude im Ergebnis landwirtschaftlich genutzt wird. Im Übrigen befinde sich die Halle direkt an einer vorbeiführenden Straße, in der Umgebung befinden sich weitere landwirtschaftliche Gebäude, insbesondere Scheunen und Maschinenhallen. Die Umgebung besteht aus Feldern, Wiesen und Äckern.
Das Amt für Landwirtschaft kommt bei einer Ortseinsicht zu dem Ergebnis, dass A auf seiner Hof-stelle zwei Silobauten hat, die bislang leer stehen und als Saatgut- und Erntelager dienen könnten.
Erfolgsaussichten der Klage?
Sounds
Einem landwirtschaftlichen Betrieb kann auch ein solches Vorhaben dienen, das nicht im Eigentum des Betriebsinhabers steht. Es bedarf dann aber besonderer Gründe, damit dieses Vorhaben dem Betrieb zugeordnet werden kann
Lösung
I. Entscheidungskompetenz des VG
Der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 VwGO ist in dieser baurechtlichen Streitigkeit offensichtlich gegeben, von der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Gerichts gem. §§ 45, 52 Nr. 1 VwGO ist auszugehen.
II. Zulässigkeit der Klage
1. Der Kläger möchte mit seinem Hauptantrag festgestellt haben, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist. In Betracht kommt daher eine Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 VwGO, wenn es sich um ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis handelt. Darunter ist jede rechtliche Beziehung zwischen einer Person und einer anderen Person oder zwischen einer Person und einer Sache zu verstehen (Kopp/Schenke, VwGO, § 43 Rd. 11). Bei der Frage der Genehmigungsfreiheit stellt sich gerade das Problem, ob durch die Genehmigungsregelungen der BayBO ein Rechtsverhältnis zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Kläger besteht, dessen Nichtbestehen soll festgestellt werden, da der Kläger der Ansicht ist, für die Errichtung der Halle sei eine Genehmigung nicht erforderlich.
2. Die Klage ist nicht subsidiär gem. § 43 Abs. 2 VwGO, die Behörden haben die Feststellung der Genehmigungsfreiheit abgelehnt, so dass nunmehr keine andere Möglichkeit als diejenige einer Klageerhebung in Betracht kommt. Die Stellung eines Verpflichtungsantrags ist nicht vorrangig, da der Kläger seinen Rechtsstandpunkt, es sei keine Genehmigung notwendig, nicht verlassen muss.
3. Der Kläger ist klagebefugt gem. § 42 Abs. 2 VwGO analog, da er gem. Art. 14 GG einen Anspruch darauf hat zu bauen unabhängig von der Frage, ob das Vorhaben einer Genehmigung bedarf. § 42 Abs. 2 VwGO ist auch analog an-zuwenden, um auch im Rahmen dieser Klageart Popularklagen effektiv zu verhindern.
4. Das Feststellungsinteresse gem. § 43 Abs. 1 VwGO kann sich aus jedem rechtlich schutzwürdigen Interesse ergeben, sei es materieller oder ideeller Art. Insbesondere ist von einem berechtigten Interesse auszugehen, wenn Uneinigkeit herrscht über eine Rechtsfrage zwischen dem Kläger und den Behörden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, § 43 Rd. 24). Gerade dies ist aufgrund der Auseinandersetzungen um die Frage der Genehmigungspflichtigkeit des Gebäudes der Fall.
5. Vom Vorliegen der restlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen ist mangels gegenteiliger Angaben auszugehen.
III. Begründetheit der Klage
Die gegen den Freistaat Bayern als Träger der Behörde, die das Rechtsverhältnis als gegeben ansieht zu richtende Klage ist begründet, wenn zwischen dem Kläger und dem Beklagten tatsächlich kein durch eine Genehmigungspflichtigkeit vermitteltes Rechtsverhältnis besteht, § 43 VwGO.
Fraglich ist daher alleine, ob das Vorhaben unter einen Tatbestand des Art. 57 BayBO fällt und von daher ein Genehmigungsverfahren nicht durchzuführen ist.
1. Grundsätzlich folgt die Genehmigungspflichtigkeit aus Art. 55 Abs. 1, 2 Abs. 1 BayBO, da es sich um eine ortsfeste, auf Dauer ausgerichtete Anlage handelt.
2. Eine Verfahrensfreiheit könnte sich jedoch aus Art. 57 Abs. 1 Nr. 1c BayBO ergeben, da das Vorhaben lediglich eine Grundfläche von 100m² aufweist.
Dazu müsste das Vorhaben allerdings der Landwirtschaft dienen.
Anmerkung: Über diesen Weg des Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 c BayBO werden letztlich nahezu dieselben Fragen aufgeworfen wie bei § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.
a) Ein Vorhaben dient i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB bzw. Art. 57 Abs. 1 Nr. 1c BayBO nur dann einem landwirtschaftlichen Betrieb, wenn ein Landwirt auch - und gerade unter Berücksichtigung des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs - dieses Vorhaben mit etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb errichten würde und das Vorhaben durch diese Zuordnung zu einem konkreten Betrieb auch äußerlich erkennbar geprägt wird (vgl. BVerwG, U.v. 3.11.1972, BVerwGE 41, 138).
Das Merkmal des Dienens ist zu verneinen, wenn das Vorhaben zwar nach seinem Verwendungszweck grundsätzlich gerechtfertigt ist, nach seiner Ausgestaltung, Beschaffenheit oder Ausstattung aber nicht durch diesen Verwendungszweck geprägt wird. Der eigentliche Zweck des Erfordernisses des „Dienens“ liegt darin, Missbrauchsversuchen begegnen zu können. Nicht der behauptete Zweck des Vorhabens, sondern seine wirkliche Funktion ist entscheidend. Es sollen Vorhaben verhindert werden, die zwar an sich objektiv geeignet wären, einem privilegierten Betrieb zu dienen, mit denen aber in Wirklichkeit andere Zwecke verfolgt werden (vgl. BayVGH, U.v. 13.1.2011 – 2 B 10.269 – juris m.w.N.).
Wesentlichkeit der Bauherreneigenschaft?
b) Im vorliegenden Fall soll der Kläger nach seinen eigenen Angaben Bauherr sein. Die Gerätehalle wird jedoch vom Grundstückseigentümer errichtet und finanziert. Dieser soll auch Eigentümer der Gerätehalle werden, die dann mit dem Grundstück an den Kläger verpachtet werden soll.
Für das Merkmal des „Dienens“ nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und Art. 57 Abs. 1 Nr. 1c BayBO ist eine Zuordnung des Gebäudes zum Betrieb erforderlich, diese ist nicht schon dann zu verneinen, wenn das zu beurteilende Vorhaben nicht im Eigentum des Betriebsinhabers steht oder von ihm allein genutzt werden soll (vgl. BVerwG, U.v. 14.4.1978 – 4 C 85.75 – BRS 33 Nr. 59). Es ist weder rechtlich noch tatsächlich schlechthin ausgeschlossen, dass einem landwirtschaftlichen Betrieb auch ein solches Vorhaben „dient“, das von einem anderen als dem Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs errichtet wird und das auch nicht in das Eigentum des Betriebsinhabers fällt.
Es bedarf jedoch hier besonderer Gründe, damit das Vorhaben in der erforderlichen Weise dem Betrieb zugeordnet werden kann.
Im vorliegenden Fall wird das Vorhaben sogar vom Kläger als dem Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs errichtet. Jedoch beträgt der Pachtzins lediglich 300 Euro pro Jahr, obwohl eine Summe von 4.000 Euro üblich ist. Tritt aber der Landwirt als Bauherr für ein Gebäude auf, das vom Eigentümer auf seinem eigenen Grundstück finanziert wird und hat der Landwirt nur einen in keiner Weise marktüblichen Pachtzins zu entrichten, so deuten alle Umstände darauf hin, dass das Vorhaben in Wirklichkeit einem anderen Zweck dient, da der Eigentümer in wirtschaftlich nicht nachvollziehbarer Weise handelt.
Von daher existiert der begründete Verdacht, dass das landwirtschaftliche Bauvorhaben nur vorgeschoben ist und in Wirklichkeit ein anderer Vorhabenszweck verfolgt wird. Ein vernünftiger Landwirt, auf den hier abzustellen ist (vgl. BVerwG, U.v. 3.11.1972 a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen, U.v. 15.2.2013 – 10 A 1606/11 – juris), würde sich auf solch ein vorgeschobenes Bauvorhaben nicht einlassen.
Prinzip der Schonung des Außenbereichs führt zur Pflicht der Verwendung bestehender Gebäude
c) Darüber hinaus „dient“ ein Vorhaben nur dann, wenn es für den vernünftigen Landwirt keine betriebliche Alternative gibt. Insbesondere die freien Raumkapazitäten sind zu beachten.
Nach den Ausführungen des Landwirtschaftsamtes bestehen freie Raumkapazitäten in Silobauten, die sich auf dem Hofgelände des Klägers befinden. Selbst wenn hier geringfügige Umbaumaßnahmen erforderlich sind, würde ein Landwirt, dem an der Schonung des Außenbereiches gelegen ist, die bestehenden Gebäude nutzen und keine weitere Zersiedelung des Außenbereiches in Kauf nehmen.
Damit dient das Vorhaben nicht der Landwirtschaft, so dass eine Genehmigungsfreiheit nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1c BayBO nicht in Frage kommt, der Hauptantrag ist damit unbegründet.
Eintritt der innerprozessualen Bedingung => Entscheidung über den Hilfsantrag
IV. Da der Hauptantrag abgewiesen wurde, ist die innerprozessuale Bedingung des Hilfsantrages eingetreten, so dass über diesen zu entscheiden ist.
1. Verpflichtungsklage gem. § 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO
1. Im Hilfsantrag wendet sich der Kläger gegen die Ablehnung der Erteilung einer Baugenehmigung für die „Errichtung einer landwirtschaftlichen Gerätehalle mit Saatgut- und Erntespeicher“, er will die Erteilung der Genehmigung erreichen, bei der es sich um einen VA gem. Art. 35 S. 1 BayVwVfG handelt, so dass die Verpflichtungsklage gem. § 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO einschlägig ist.
Diese Klage wäre auch zulässig, da der Kläger nach Art. 68 Abs. 1 BayBO einen möglichen Anspruch auf die Erteilung der Genehmigung hat, von den übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen kann ausgegangen werden.
2. Begründetheit der Klage im Hilfsantrag
Die gem. § 78 abs. 1 Nr. 1 VwGO gegen den Freistaat Bayern zu richtende Klage wäre begründet, wenn der Kläger einen Anspruch auf die Erteilung der begehrten Genehmigung hat, § 113 Abs. 5 VwGO.
a) Anspruchsgrundlage für die Erteilung einer Baugenehmigung ist Art. 68 Abs. 1 BayBO.
b) Vom Vorliegen der formellen Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere der Stellung eines ordnungsgemäßen Bauantrags gem. Art. 64 BayBO ist auszugehen.
c) Die materiellen Erteilungsvoraussetzungen sind gegeben, wenn das Vorhaben genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig ist.
aa) Wie bereits geklärt, fällt das Vorhaben nicht unter die Normen der Verfahrensfreiheit, insbesondere Art. 57 Abs. 1 Nr. 1c BayBO ist nicht einschlägig.
bb) Da es sich bei dem Vorhaben nicht um einen Sonderbau gem. Art. 2 Abs. 4 BayBO handelt, richtet sich die Genehmigungsfähigkeit nur nach den Vorschriften, die im vereinfachten Genehmigungsverfahren zu prüfen sind, Art. 59 BayBO.
(1) Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich, seine planungsrechtliche Zulässigkeit orientiert sich an § 35 BauGB.
(2) Es wurde bereits geklärt, dass das Vorhaben nicht unter § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB fällt, da es nicht der Landwirtschaft i.S.d. § 201 BauGB dient. Es handelt sich um ein sonstiges Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB, bei dem fraglich ist, ob öffentliche Belange beeinträchtigt werden, § 35 Abs. 3 BauGB.
(a) Insbesondere kommt in Betracht, dass das Vorhaben zur Verfestigung einer Splittersiedlung führt, § 35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB.
„Splittersiedlungsargument“ trotz vorhandener Bebauung in der Umgebung?
Der Kläger geht davon aus, dass durch die umliegenden Gebäude die Zersiedelung der Gegend so weit fortgeschritten ist, dass ein weiteres Gebäude daran nichts ändert. Aufgrund der Lage des Vorhabens unmittelbar an einer Straße sei auch keine nennenswerte zusätzliche optische Veränderung des natürlichen Landschaftsbilds zu befürchten.
Dem Begriff der Splittersiedlung steht zunächst nicht entgegen, dass es sich bei dem Vorhaben nicht um ein Wohngebäude, sondern um eine sonstigen Zwecken dienende Halle handeln soll. Denn auch bauliche Anlagen, die mit dem vorübergehenden Aufenthalt von Menschen verbunden sind, können im Hinblick auf den Schutzzweck des öffentlichen Belangs nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB die Gefahr einer Zersiedlung begründen (vgl. BayVGH, U.v. 26.9.2011 – 1 B 11.550 – juris).
Zweck der Regelung des § 35 BauGB ist es, die Bebauung des Außenbereichs möglichst auf privilegierte Bauvorhaben zu beschränken. Die Erteilung der beantragten Baugenehmigung hätte für ähnliche Bauvorhaben eine unerwünschte Vorbildwirkung, da es viele ehemals zulässige landwirtschaftliche Gebäude im Außenbereich gibt, an deren Stelle nicht privilegierte Neubauten errichtet werden könnten. Daher ist nicht trotz, sondern gerade wegen einer bereits vorhandenen Bebauung darauf zu achten, dass diese nicht weiter fortschreitet.
Schutzwürdiges Landschaftsbild bei Wiesen und Äckern?
(b) Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt. Das ist hier der Fall, da die Landschaft von nicht privilegierter Bebauung grundsätzlich freigehalten werden soll. Es kommt dabei nicht darauf an, ob das Vorhaben mehr oder weniger auffällig in Erscheinung tritt.
Die Errichtung eines nicht privilegierten Gebäudes steht dem Schutz der natürlichen Eigenart der Landschaft nur dann nicht entgegen, wenn es nur unerhebliche Auswirkungen auf die Umgebung hätte.
Auch wenn die Umgebung landwirtschaftlich genutzt wird, bedeutet dies nicht, dass die Landschaft deshalb nicht schutzwürdig ist. Die Eigenart der Landschaft im Außenbereich besteht gerade darin, überwiegend von Bebauung frei zu sein. Dies würde durch das Vorhaben beeinträchtigt.
Damit kann das Vorhaben aufgrund der beeinträchtigten öffentlichen Belangen nicht genehmigt werden, die Klage ist auch im Hilfsantrag unbegründet.